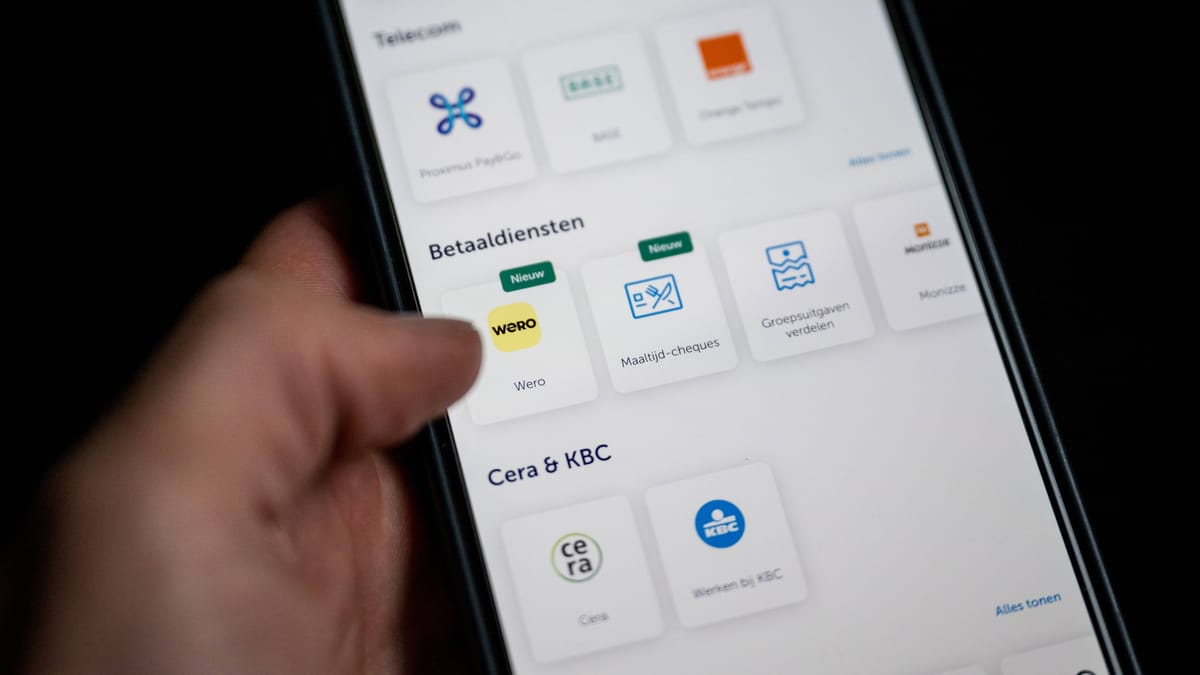Der Großteil der Eltern sorgt sich um die Onlinesicherheit ihrer Kinder. Moderne Technik bietet Chancen, doch auch unzählige Gefahren, warnt eine Expertin.
Die meisten Kinder erhalten ihr erstes internetfähiges Gerät – etwa ein Smartphone oder ein Tablet – durchschnittlich im Alter von neun Jahren, so eine aktuelle Online-Umfrage von Google unter Eltern. Die Gründe dafür mögen vielfältig sein und reichen vermutlich von einer besseren Erreichbarkeit in ländlichen Regionen bis hin zum Gruppenzwang im Freundeskreis.
Doch vernetzte Kinder schaffen auch ganz neue Problemfelder für Eltern. Plötzlich geht es nicht mehr nur um zu viel Medienkonsum durch Filme oder Serien. Auf einmal werden die Kleinen mit Inhalten konfrontiert, die alles andere als altersgerecht sind. Falsche oder irreführende Inhalte, Missachtung der Privatsphäre, KI-generierte Deepfakes oder Cybermobbing – um nur einige Beispiele zu nennen.
Lidia de Reese meint, das Spektrum der Gefahren sei riesig. Sie ist Referentin für Medienbildung bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia (FSM) und fördert die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen – aber auch von Eltern und pädagogischen Fachkräften. Im Interview mit t-online erklärt sie, was bei diesem Thema wichtig ist.
t-online: Frau de Reese, worauf kommt es bei der Förderung von Medienkompetenz bei Kindern an?
Lidia de Reese: Wir reden immer von einem Dreiklang aus Schutz, Befähigung und Teilhabe. Es darf nicht nur darum gehen, Kinder und Jugendliche vor problematischen Sachen zu schützen. Das ist superwichtig für Minderjährige, aber es muss mehr sein. Sie müssen befähigt werden und einen Weg gezeigt bekommen, wie sie auch Teil der digitalen Welt sein können. Denn das ist nun mal ihr Leben, für Kinder und Jugendliche besteht kein Unterschied zwischen digital und analog. Das wird nicht getrennt, das ist alles eins.
Laut der Onlinebefragung von Google ist es für fast die Hälfte der Eltern schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu finden, Sicherheit im Netz zu thematisieren. Woran liegt das?
Das Grundproblem ist, dass wir eine Balance finden müssen zwischen den Bedürfnissen des Kindes – spannende Inhalte auf den Geräten zu konsumieren – und dem Schutzbedürfnis von Eltern. Das ist oft gar nicht so leicht. Und dann kommt auch unsere Vorbildrolle als Erwachsene hinzu – und da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Viele Kinder sehen ihre Eltern seit ihrer Geburt ständig mit einem Smartphone in der Hand – für die gehört das zur Normalität. Da ist es dann umso schwerer, sich als Erwachsener hinzustellen und zu sagen: „Du darfst das aber nicht.“
Lidia de Reese, Medienpädagogin (M.A.), ist bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM e. V.) als Referentin für Medienbildung tätig. Ihr Schwerpunkt liegt in der Aufklärungsarbeit und Medienkompetenzförderung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Lehrkräften – unter anderem mit der Plattform für die Medienerziehung Elternguide.online. Zuvor arbeitete sie als Medienpädagogin bei der Kindersuchmaschine fragFINN.de sowie beim medienpädagogischen Fort- und Weiterbildungsinstitut BITS 21.
Welche Auswirkungen hat es denn, wenn Eltern den richtigen Moment verpassen oder selbst gar nicht in der Lage sind, dem eigenen Kind das Thema nahezubringen?
Das Spektrum der Gefahren, die im Netz lauern, ist riesig. Da reden wir über problematische und gefährliche Inhalte und Desinformation – oder dass man potenziell von fremden Menschen angesprochen werden kann. Auf der einen Seite ist es schwierig für Eltern, da durchzusteigen. Und dann muss man auch die richtige Sprache finden. Ich kann Kinder und Jugendliche über Cybergrooming aufklären. Ich muss mit sechs- oder siebenjährigen Kindern aber anders sprechen als mit 14- oder 15-Jährigen. Ich möchte ja auch das Kind nicht verängstigen, aber trotzdem sicherstellen, dass es versteht: Nicht alle meinen es gut mit dir.
Worauf kommt es dabei am meisten an?
Das Allerwichtigste ist, altersgerecht über Online-Risiken wie Cybermobbing, Desinformation und sexuelle Belästigung aufzuklären und das Thema auch immer anzusprechen. Dadurch zeigen wir Interesse und nur dann reden Kinder und Jugendliche auch mal von selbst darüber. Außerdem wissen Eltern dadurch, auf welchen Seiten und Plattformen ihre Kinder unterwegs sind – und können sich darüber informieren. Es sollte ein vertrauensvoller Dialog über Medien zwischen Eltern und Kind bestehen bleiben. Nur dann werden Kinder und Jugendliche Hilfe suchen, wenn sie negative Erfahrungen machen. Reine Verbote auszusprechen, wäre zum Beispiel eher kontraproduktiv.
In der Befragung haben 80 Prozent der Eltern angegeben, dass sie genug über das Thema Onlinesicherheit wissen, um ihre Kinder aufzuklären. Halten Sie diesen Wert für realistisch?
Ich sehe das etwas kontrovers. In ihrer eigenen Nutzung fühlen sich die meisten Eltern wahrscheinlich kompetent. Viele bekommen aber auch oft gar nicht mit, auf welchen Plattformen ihre Kinder unterwegs sind oder welche Spiele sie spielen. Da passieren dann oft Dinge, die Eltern gar nicht wissen können. Hier ist es wichtig, auch die Eltern aufzuklären und zu zeigen, dass durchaus noch Risiken lauern, von denen sie gar nichts wissen.