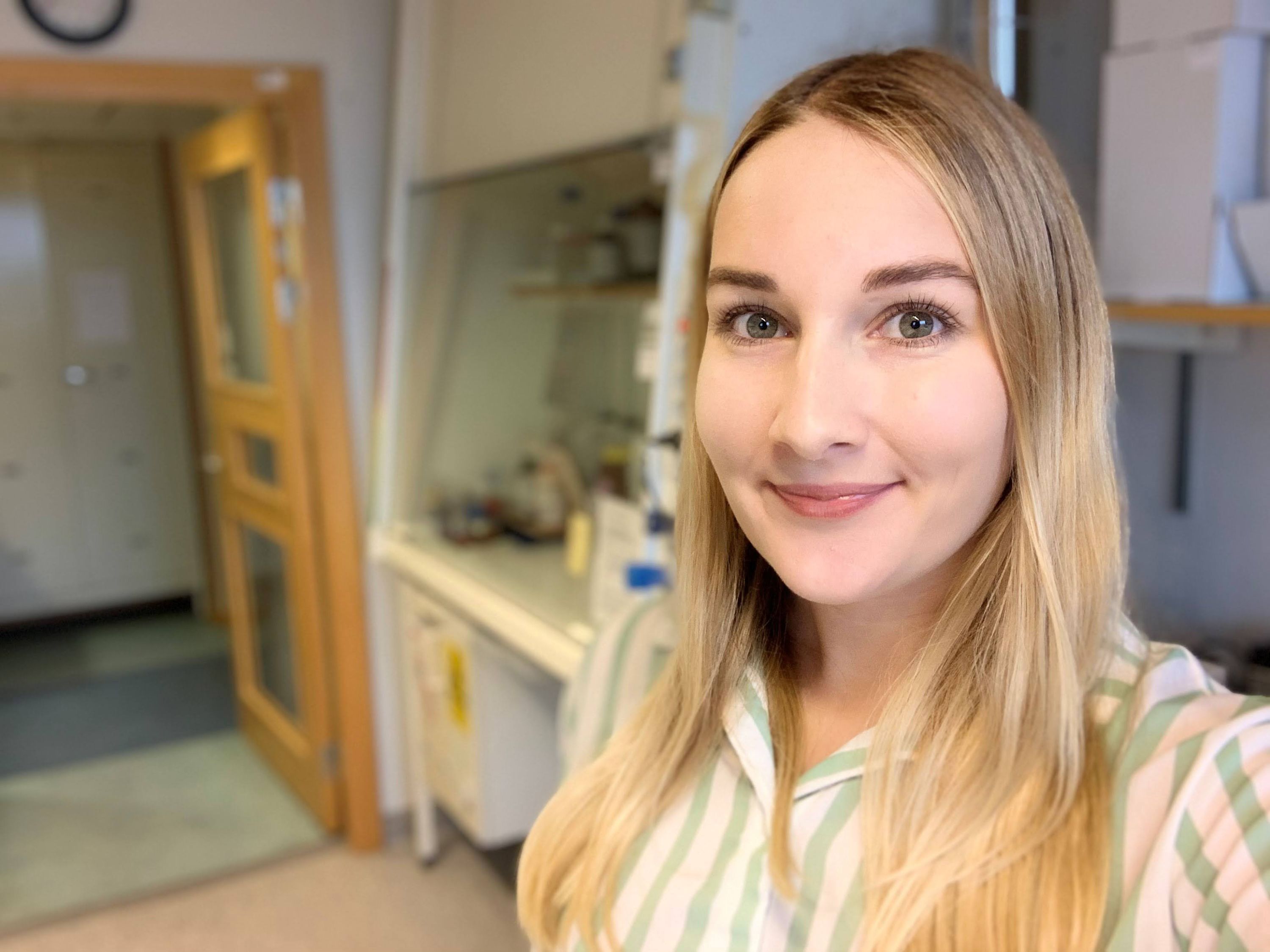Wenn Donald Trump mit amerikanischen Traditionen bricht, welche Auswirkungen wird seine Wahl Ihrer Meinung nach auf die transatlantischen Beziehungen haben?
Leider lässt sich das kaum vorhersagen, aber ich befürchte, dass die USA in diesem Fall introvertiert werden und in einen heftigen inneren gesellschaftlichen Konflikt geraten würden: Außenpolitisch würde es dann weniger um eine konkrete Positionierung als vielmehr um den Aufbruch Amerikas gehen von der Weltbühne. Wenn sich die USA von ihren europäischen Verbündeten wie Deutschland sowie von ihren traditionellen Partnern im pazifischen Raum abwenden, besteht die Gefahr, dass dies die allgegenwärtige globale Unordnung, die wir derzeit erleben, verschärft.
Was können wir von Kamala Harris als US-Präsidentin im Hinblick auf die internationalen Beziehungen erwarten?
Im Gegensatz zu Donald Trump können wir mit Kontinuität rechnen. Kamala Harris ist bereits Mitglied einer Regierung, die den Wert internationaler Koordination und Partnerschaften erkennt. Natürlich sind von ihr auch für Deutschland bedeutsame Akzentverschiebungen zu erwarten. Das Ausmaß, in dem sich die amerikanische Bevölkerung verändert – eine stärkere Ausrichtung der USA auf Lateinamerika und Asien – wird in Europa immer noch weitgehend übersehen.
Könnten Sie erklären, was Sie damit meinen?
Neben der Pflege der Kontakte zu den etablierten Akteuren und Institutionen des transatlantischen Dialogs muss Deutschland auch die Beziehungen zu den aufstrebenden Minderheiten in Amerika deutlich vertiefen. Mit fast 70 Millionen Latinos haben die USA bereits die zweitgrößte spanischsprachige Bevölkerung der Welt. Bis 2050 werden in den USA über 100 Millionen Latinos leben, während das Wachstum der asiatisch-amerikanischen Bevölkerung relativ gesehen noch schneller ausfällt. Dies wird dazu beitragen, Amerika enger mit Partnern in Lateinamerika und Asien zusammenzubringen. Auch hier können Europa und die USA als transatlantische Partner fungieren, wobei Deutschland und anderen europäischen Staaten in diesem Zusammenhang aus militärischer Sicht keine besondere Rolle zuzumuten ist. Aber auch im pazifischen Raum können sie als transatlantische Partner Amerikas auftreten und wichtige politische Impulse etwa in den Bereichen Umwelt, Wirtschaft, Handel und Entwicklung setzen – und das sind Aspekte, die sicherlich stärker in den Vordergrund rücken werden unter einer Harris-Administration.
Veränderungen in den internationalen Beziehungen stehen im Mittelpunkt des Projekts „Nexus25 – Shaping Multilateralism“, das Sie gemeinsam leiten. Auf welche Themen konzentriert sich das Projekt?
Gefördert durch die deutsche Stiftung Mercator, Nexus25 ist ein Projekt, das eine Zusammenarbeit zwischen dem Washington Center for Climate and Security und dem italienischen Istituto Affari Internazionali beinhaltet. Unser Ziel ist es, die Botschaft zu vermitteln, dass die Diskussion über Außen- und Sicherheitspolitik viel weiter gehen muss, um sogenannte Nexus-Fragen zu behandeln, also wie Klimawandel, Migrationsbewegungen, Fragen der Ernährungssicherheit und regionale Stabilität miteinander verknüpft sind. Dies erfordert ein völlig anderes politisches und intellektuelles Instrumentarium als die zweidimensionale West-Ost-Denkweise, die aus der Zeit des Kalten Krieges überlebt hat. Die Lage im 21. Jahrhundert ist viel unbeständiger – nicht nur aus militärischer Sicht. Eine scharfe Unterscheidung zwischen Außenpolitik, Entwicklungspolitik und Sicherheitspolitik macht keinen Sinn mehr. Also das Ziel von Nexus25 ist es, auf diese Weise die geopolitische Debatte zu eröffnen.