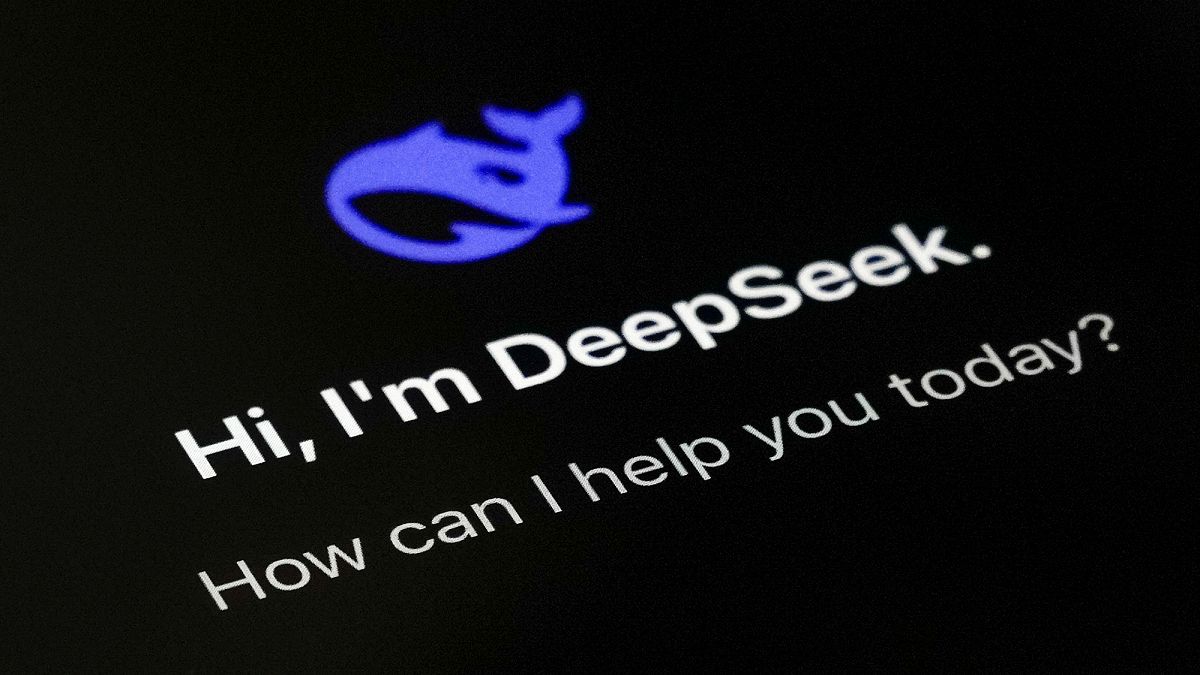Seit mehr als einem Jahr herrscht Unruhe in der europäischen Agrarpolitik.
Mit medienwirksamen Misthaufen-Initiativen, Autobahnblockaden und Traktorenkundgebungen in Hauptstädten versuchen vor allem die großen Bauernverbände mit ihren überwiegend konventionell angebauten Mitgliedern, den „Green Deal“ der Europäischen Kommission auf den Schlachthof zu bringen. Doch was ist mit den klimabewussten Landwirten, die gehofft hatten, dass der „Green Deal“ ihnen, ihrem Land und der Umwelt zugute kommen würde? Eine Recherche unseres Reporters Hans von der Brelie in Auersthal, einem kleinen Dorf im äußersten Osten der Republik Österreich.
Herbert Zetner steht jeden Tag um vier Uhr morgens auf. Draußen ist es immer noch stockdunkel. Aber wie viele Biobauern muss Zetner zwei Jobs unter einen Hut bringen. Bis zum frühen Nachmittag arbeitet er als IT-Experte bei einer Bank in Wien. Dann wechselt er von seinem Bürostuhl auf den Fahrersitz seines Traktors. Im Marchfeld, einer großen Schwemmebene nahe der österreichischen Hauptstadt, sät er an diesem Novembertag Leindotter, auch Leindotter oder Leindotter genannt.
Das Marchfeld gilt als „Kornkammer Österreichs“, doch wenn man durch die hübschen Dörfer mit ihren kaisergelben Häuserfassaden fährt, fällt auf, dass viele Felder recht schmal sind und wie verschiedenfarbige Handtücher nebeneinander ausgelegt sind. Das ist Streifenschneiden. Mit dieser Methode versuchen Biobauern, die Wunden zu heilen, die ehemalige Monokulturen mit ihren riesigen Feldern in der Landschaft geschlagen haben.
Die konventionelle Landwirtschaft hat auf dem Marchfeld verheerende Schäden angerichtet: Überdüngung, Übernutzung der Grundwasserreserven und fehlende Hecken haben zu massivem Artenverlust und Bodenerosion bis hin zur Wüstenbildung geführt. Die Ebene überhitzte, sie trocknete aus – und um Wien weiterhin mit Gemüse zu versorgen, griffen viele Bauern umgehend auf den Einsatz giftiger Substanzen und Kunstdünger zurück.
Doch auch in der Familie Zetner zeichnet sich mittlerweile ein Umdenken ab. „Früher habe ich mich mit Gift besprüht, mir war ständig schlecht“, sagt Herbert. Als sein Vater verstarb, übernahmen Herbert und sein Bruder den Hof und stellten auf ökologischen Landbau um. Anstelle von Fungiziden und chemischen Düngemitteln verwendet Zetner einen selbst hergestellten Heutee aus fermentierten Gräsern.
Ökologischer Landbau bedeute oft mehr Arbeit, sagt Zetner: „Früher brauchten wir mit konventioneller Landwirtschaft fast 500 Stunden für unsere 74 Hektar Felder und Wald. Jetzt brauchen wir mit regenerativer Landwirtschaft 1500 Stunden. Damit haben wir das Dreifache.“ Bemühung!“. Dennoch scheint Herbert mit sich und der Welt zufrieden zu sein. „Früher galt Bio als exotisch, doch mittlerweile erkennt man, dass Bio normal ist“, fasst er zusammen.
Herbert baut 24 verschiedene Feldfrüchte an. Lustgold (Leindotter), Hafer, Dinkel, Gerste, Roggen, Kichererbsen, Kümmel, Türkische Melisse (Zitronenmelisse) … die Liste ist lang! Der Nebenerwerbslandwirt betreibt regenerative Landwirtschaft und ist seit fünf Jahren offiziell als Biobauer zertifiziert.
Derzeit läuft ein EU-weites Forschungsprojekt, um herauszufinden, wie CO2 aus der Luft besser im Boden gebunden werden kann. Der Anbau von CO2-Abscheidern verlangsamt den Klimawandel; und Landwirte, darunter auch Herbert Zetner, freuen sich über fruchtbaren Humus. Stolz zeigt er mir eine kleine Pflanze, die er aus der lockeren Erde gezogen hat: „Hier sieht man, wie sich die Erde an den Wurzeln festklammert. Das bedeutet ein super Zusammenspiel der Pflanze mit der Erde. Der Humus wird von den Wurzeln gut durchdrungen.“ und fein zerbröckelt, das gefällt mir!“
Der Humusaufbau funktioniert mit Streifenanbau und Zwischenfruchtanbau (mehrere Kulturen werden mit- und nebeneinander angebaut); ein Gegenmodell zu Monokulturen und Riesenfeldern. Um den Klimawandel und das Artensterben zu bremsen, hatte die Europäische Kommission geplant, alle Landwirte dazu zu verpflichten, vier Prozent ihrer Flächen brach zu lassen. Proteste konventioneller Landwirte führten jedoch dazu, dass dies im Frühjahr (2024) aufgehoben wurde. Daher meine Frage an Zetner: „Brachflächen, Fruchtfolgen und Blühstreifen – sollten diese in der Europäischen Union verpflichtend oder freiwillig sein?“ Während er die Sämaschine über das Feld lenkt, sagt Herbert Zetner in seinem bedächtigen, nachdenklichen Ton: „Ich finde, es sollte Pflicht sein.“
Heute sät Herbert die Wintersaat. Seine Felder sollten unabhängig von der Jahreszeit immer grün sein. Das ist auch gut für die CO2-Bilanz. Von der EU will er nicht nur schöne Worte, sondern auch eine höhere Bio-Prämie und eine finanzielle Entschädigung für seine vielen Bio-Arbeitsstunden: „Landwirte, die auf den Humusaufbau achten, wollen etwas für die Natur tun. Das soll sich auch finanziell lohnen.“ Ich trenne CO2! Ich tue viel Gutes! Das sollte von der EU anerkannt werden!“
Internationale Autoritäten auf dem Gebiet der Biodiversitätsforschung, wie etwa Professor Franz Essl von der Universität Wien, sind dieser Meinung. Um den Klimawandel, das Artensterben, die Bodenerosion und die Wüstenbildung zu verlangsamen, müsste die Landwirtschaft ihre Anbaumethoden ändern. Dafür brauche es finanzielle Anreize, sagt Essl: „Der Atmosphäre CO2 zu entziehen, ist etwas, was die Landwirtschaft leisten kann. Wenn der Boden anders bearbeitet wird, verbleibt mehr Humus im Boden und das dürfte für die Gesellschaft von größerem Wert sein als bisher.“ ”
Die Empfehlungen des Weltexperten für die europäische Agrarpolitik sind klar: Wiedervernässung trockengelegter Feuchtgebiete, Brachlandwirtschaft (also regelmäßige Stilllegung einiger Felder), Windschutzhecken, Humusaufbau. usw. Die EU-Kommission dürfe der mächtigen Großbauernlobby nicht nachgeben, „sondern sie sollte auf Kurs bleiben“, sagt Essl.
In einem kürzlich veröffentlichten Sonderbericht hat der Europäische Rechnungshof auch die bisherigen „Aktionspläne“ der EU zur Förderung des ökologischen Landbaus unter die Lupe genommen und die Europäische Kommission scharf gerügt: Es fehle an einer Gesamtstrategie. Noch immer erfolgt die Geldverteilung nach dem Gießkannenprinzip. Und wenn die Europäische Union ihr selbstgestecktes Ziel erreichen will, bis 2030 25 Prozent der Agrarfläche biologisch anzubauen, braucht sie nicht nur bessere Vermarktungsstrategien für Bio-Produkte, sondern auch verbindliche und „messbare Ziele“.