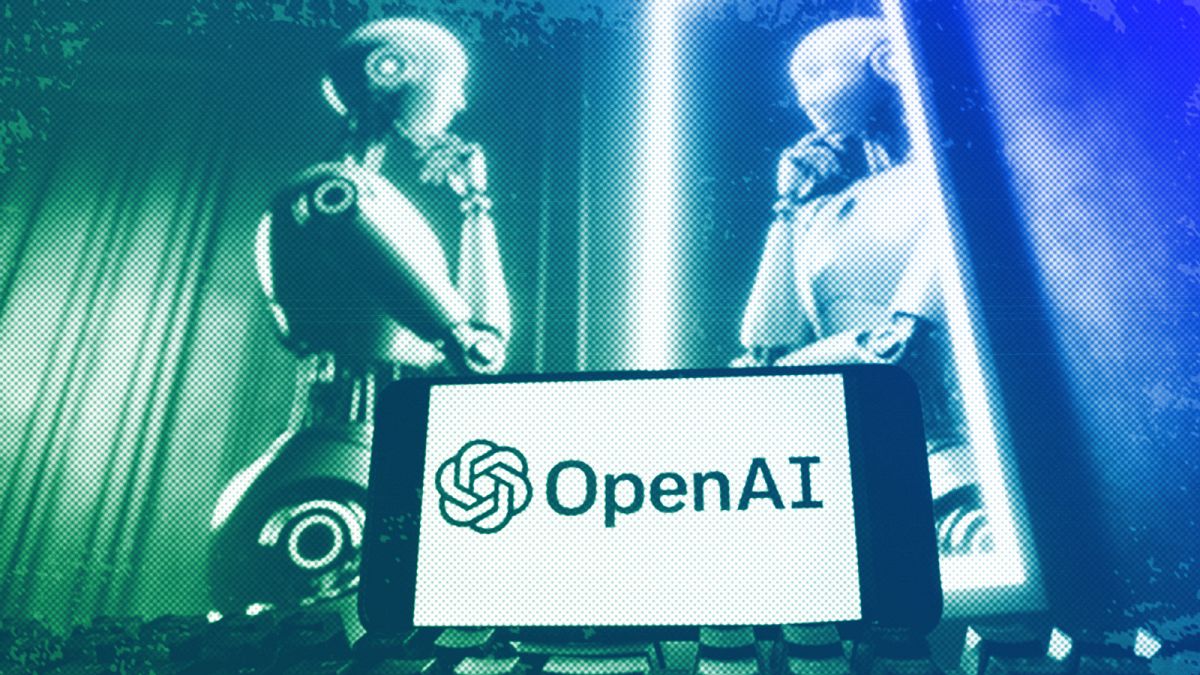Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind die des Autors und spiegeln in keiner Weise die redaktionelle Position von Euronews wider.
Hoffen wir zum Wohle der Presse und all dessen, was auf sie angewiesen ist – das gesellschaftliche Leben, die Demokratie usw. –, dass die Medienbosse, die große Verträge mit OpenAI abschließen, diesmal tatsächlich auf die richtige Wette mit den großen Technologieunternehmen setzen, schreibt Jonah Prousky.
In den letzten Monaten hat ChatGPT-Entwickler OpenAI die größten Nachrichtenmedien der Welt mit lukrativen Partnerschaftsverträgen überhäuft. Der genaue Betrag, den das Unternehmen ausgegeben hat, um die Taschen der Verleger zu füllen, ist unbekannt, könnte aber durchaus in die Milliarden gehen.
So unterzeichnete etwa News Corp., dem das Wall Street Journal, die New York Post und die Sunday Times gehören, im vergangenen Monat einen Vertrag mit OpenAI, der Berichten zufolge einen Wert von 250 Millionen Dollar (233,3 Millionen Euro) hat.
Auch die Financial Times, The Atlantic, Associated Press, Dotdash Meredith – dem People Magazine und Investopedia gehören – und Axel Springer, dem Business Insider und Politico gehören, haben allesamt Verträge mit dem von Microsoft unterstützten KI-Riesen abgeschlossen.
Was also kauft OpenAI genau? Es stellt sich heraus, dass sich Veröffentlichungen, insbesondere ihre Online-Archive, hervorragend zum Trainieren von KI eignen.
Obwohl viele dieser Inhalte mithilfe eines Webcrawlers kostenlos abgerufen werden können, war OpenAI aufgrund dieser rechtlich undurchsichtigen Vorgehensweise bislang häufig Klagen ausgesetzt.
Diese Vereinbarungen könnten das Unternehmen daher aus einer rechtlichen Zwickmühle befreien und ein Bollwerk gegen künftige weitere Urheberrechtsprobleme darstellen.
Darüber hinaus erlauben einige der Vereinbarungen OpenAI, Nachrichteninhalte in ChatGPT-Antworten anzuzeigen. Dies soll wahrscheinlich eine neue Suchfunktion unterstützen, an der das Unternehmen arbeitet. Laut Bloomberg könnte ChatGPT damit das Internet durchsuchen und Quellen zitieren, wenn es auf die Eingabeaufforderung eines Benutzers antwortet.
Großartig, werden Sie vielleicht sagen, OpenAI bekommt Futter für seine Modelle und die Medien erhalten eine dringend benötigte Finanzspritze.
Aber Medienunternehmen haben sich schon früher an Big Tech die Finger verbrannt. Und jetzt gehen sie eine Partnerschaft mit dem vielleicht größten und revolutionärsten Technologieunternehmen aller Zeiten ein, ohne zu wissen, welche weitreichenden Auswirkungen KI auf ihr Geschäft haben könnte.
„Hilf mir, mir zu helfen“
Denken Sie an die Auswirkungen, die Google und Facebook in den letzten zwei Jahrzehnten auf die Presse hatten.
Einerseits haben diese Plattformen den Nachrichtenunternehmen einen enormen Dienst erwiesen. Such- und Social-Media-Plattformen sorgen heute für den Löwenanteil des Datenverkehrs auf den meisten Nachrichtenseiten.
Laut Cris Turner, Vizepräsident für Regierungsangelegenheiten und öffentliche Ordnung bei Google, „verlinken unsere Produkte Menschen jeden Monat über 24 Milliarden Mal auf die Websites von Herausgebern – und das kostenlos. Außerdem bieten wir Abonnement-Tools und Anzeigentechnologie an, die es Herausgebern ermöglichen, diesen Datenverkehr zu monetarisieren.“
Gleichzeitig hat Googles Dominanz in der digitalen Werbung – oder das angebliche Monopol, wenn man vom US-Justizministerium spricht – die Werbeeinnahmen der Verlage versiegen lassen. Dies hat nicht zuletzt eine jahrzehntelange Welle der Konsolidierung und Schrumpfung der weltweiten Nachrichtenunternehmen ausgelöst.
Viele sind oft überrascht, wie schnell Nachrichtenagenturen, insbesondere lokale, verschwinden. Laut der Medill School of Journalism der Northwestern University werden in den USA ab 2023 mit einer erstaunlichen Rate von 2,5 Zeitungen pro Woche eingestellt. Auch in ganz Europa verschwinden Zeitungsunternehmen, und das hat viel mit sinkenden Werbeeinnahmen zu tun.
In Großbritannien etwa war der Markt für Zeitungsanzeigen im vergangenen Jahr lediglich 241 Millionen Pfund (284,7 Millionen Euro) wert. In den 2000er Jahren, als Plattformen wie Google und Facebook noch in den Kinderschuhen steckten, waren es noch 2,5 Milliarden Pfund (2,95 Milliarden Euro).
Man muss sich also fragen: Wird KI denselben Effekt auf die Presse haben wie Google?
Das Richtige tun, die richtige Wahl treffen
Vielleicht nicht. Da Google und Facebook einen so großen Teil der Werbeeinnahmen der Branche auffressen, mussten die Verlage ihre Geschäftsmodelle auf andere Einnahmequellen wie Abonnements und sogar Spenden ausrichten.
Der Guardian beispielsweise erwirtschaftet einen Großteil seiner US-Einnahmen durch die Zuwendungen seiner Leser. Vermutlich wäre es für KI-Unternehmen schwieriger, diese Einnahmen abzuschöpfen, im Gegensatz zu Werbeeinnahmen, selbst in einer Welt, in der ChatGPT Google als Eingangstor zum Internet verdrängt.
Andererseits ist noch vieles darüber, wie KI den Journalismus verändern wird, unbekannt. Was wäre, wenn die Leute ihre Nachrichten direkt von ChatGPT beziehen würden? Es ist nicht schwer, sich eine Welt vorzustellen, in der diese Plattform Nachrichten für uns kuratiert und – zum Leidwesen dieses Meinungsartikelschreibers – markige Kommentare zu aktuellen Ereignissen verfassen kann. Wenn das passieren würde, würden dann die Abonnements digitaler Zeitungen zurückgehen?
Und wird das Geld aus der Partnerschaft mit OpenAI ausreichen, um die Veröffentlichungen über Wasser zu halten? Oder besser noch: Was wird aus den Zeitungsunternehmen, denen OpenAI keine Lizenzverträge angeboten hat?
Vielleicht sollte die Presse also das Geld von OpenAI doch nicht annehmen. Vielleicht sollten die Medienunternehmen stattdessen dem Beispiel der New York Times folgen und OpenAI verklagen, weil das Unternehmen seine Inhalte ohne Entschädigung verwendet.
Oder vielleicht sollten sie warten, bis die Regierungen mit Maßnahmen wie dem kanadischen Gesetzentwurf C-18 oder dem australischen News Media Bargaining Code eingreifen. Beide waren halbwegs erfolgreiche Versuche, die großen Technologiekonzerne dazu zu zwingen, Journalisten für die Verwendung ihrer Inhalte zu entschädigen.
Aber herumzusitzen und abzuwarten, während die Konkurrenz lukrative Verträge mit OpenAI abschließt, ist wohl kaum ein gutes Geschäft. Daher kann man Medienunternehmen nicht wirklich vorwerfen, dass sie das Geld nehmen.
„Ich bin absolut davon überzeugt, dass diese Deals von Vorteil sein können, wenn wir die richtigen Regeln gelernt haben, sie richtig strukturieren und auf Nummer sicher gehen. Die Lektion des letzten Jahrzehnts für die Medien besteht nicht darin, die Technologieplattformen zu meiden – sondern darin, die richtigen Deals zu machen und auf das Richtige zu setzen“, schrieb Nicholas Thompson, CEO von The Atlantic, in einem LinkedIn-Post.
Und doch scheint es, als könne uns die Geschichte nicht viel über die Gegenwart lehren.
Die grenzenlose Ungewissheit der KI scheint jeden historischen Vergleich in den Schatten zu stellen, egal ob mit Google, Facebook oder anderen.
Hoffen wir also zum Wohle der Presse und all dessen, was auf sie angewiesen ist – gesellschaftliches Leben, Demokratie usw. –, dass Herr Thompson und alle anderen Medienmanager, die große Verträge mit OpenAI abschließen, diesmal tatsächlich auf die richtige Wette mit den großen Technologieunternehmen setzen.
Jonah Prousky ist ein kanadischer freiberuflicher Autor mit Sitz in London. Seine Arbeiten wurden in mehreren führenden Publikationen veröffentlicht, darunter der Canadian Broadcasting Corporation (CBC), dem Toronto Star und dem Calgary Herald.
Bei Euronews glauben wir, dass jede Meinung wichtig ist. Kontaktieren Sie uns unter view@euronews.com, um Vorschläge oder Anregungen einzusenden und an der Diskussion teilzunehmen.