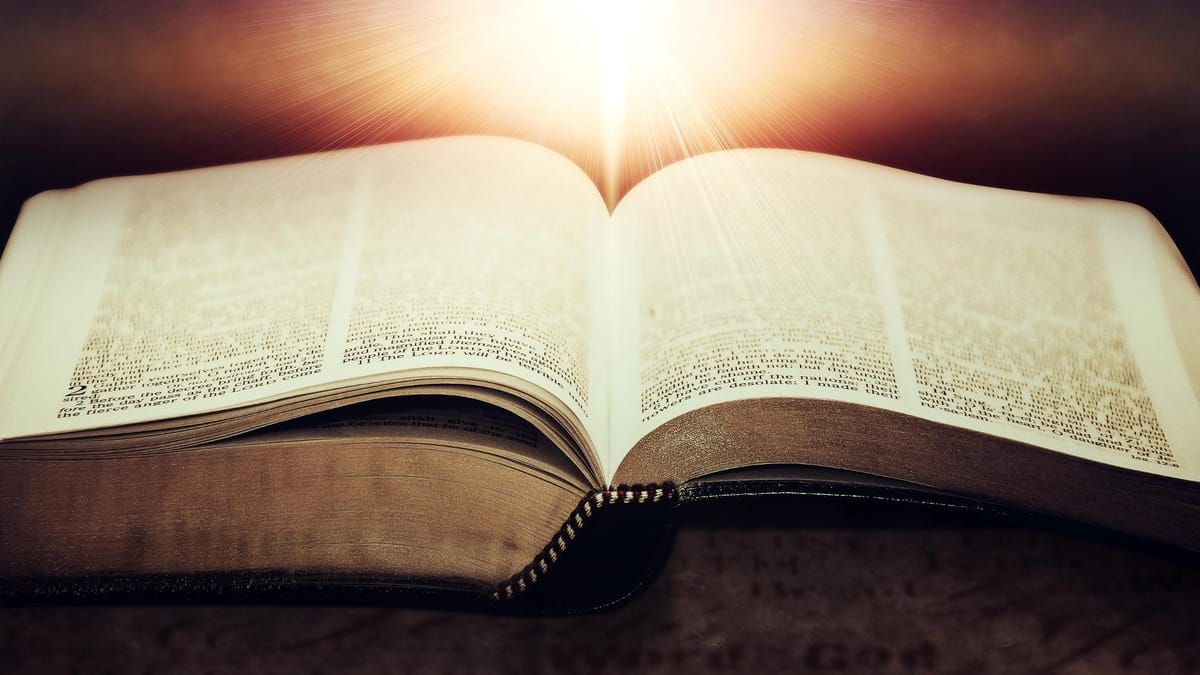Christi Himmelfahrt ist ein Feiertag, an dem auch der Vatertag gefeiert wird. Eigentlich ist das Fest aber christlich geprägt. Welche Bedeutung es hat und welche Bräuche stattfinden.
Christi Himmelfahrt ist in allen 16 Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag und gehört damit zu den bundeseinheitlichen Feiertagen. Kinder haben an diesem Tag schulfrei, Geschäfte, Ämter und Behörden bleiben geschlossen. In der katholischen, der orthodoxen und der anglikanischen Kirche wird der Feiertag als Hochfest begangen.
Außerdem gilt an Feiertagen wie Christi Himmelfahrt in der Zeit von 0 bis 22 Uhr ein Fahrverbot für Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen sowie Lkw mit Anhänger.
2025 fällt Christi Himmelfahrt auf Donnerstag, den 29. Mai. Ein festes Datum gibt es für den christlichen Feiertag aber nicht. An welchem Datum er stattfindet, wird durch seinen zeitlichen Abstand zum Osterfest berechnet: Immer 39 Tage nach dem Ostersonntag beziehungsweise 40 Tage nach Ostern wird er gefeiert. Christi Himmelfahrt fällt deshalb immer auf einen Donnerstag.
An Christi Himmelfahrt wird die Rückkehr von Jesus Christus zu seinem Vater in den Himmel gefeiert. Die Berechnung, an welchem Tag Christi Himmelfahrt gefeiert wird, bezieht sich auf das Lukas-Evangelium sowie die Apostelgeschichte von Lukas in der Bibel.
In der Apostelgeschichte 1,3 wird beschrieben, dass Jesus nach seiner Kreuzigung und der folgenden Auferstehung noch 40 Tage zu seinen Jüngern sprach und ihnen erschienen ist. An Christi Himmelfahrt wurde er vor ihren Augen emporgehoben, von einer Wolke aufgenommen und in den Himmel zur Rechten Gottes erhoben. Deshalb spricht man auch von der „Erhöhung“ Jesu Christi. Mit dieser symbolischen Erzählung soll der Weg zu Gott für alle Menschen veranschaulicht werden.
Bis zum vierten Jahrhundert galt Christi Himmelfahrt laut Angaben der Katholischen Kirche in Deutschland nicht als eigenständiger Feiertag. Nach 50 Tagen wurde die Osterzeit mit der Feier zu Pfingsten festlich abgeschlossen und zusammen mit Christi Himmelfahrt gefeiert. Erst danach erhoben ihn die Christen zu einem eigenen Festtag.
Früher wurden in Gottesdiensten häufig Christusstatuen an Seilen bis unter die Decke der Kirche gezogen, um die Himmelfahrt nach der Auferweckung besonders bildlich darzustellen. Heute existiert dieser Brauch allerdings kaum noch, da er aus theologischer Sicht ein falsches Bild vermittelt.
Die Fahrt in den Himmel – also an einen bestimmten Ort über den Wolken – ist nicht wörtlich zu nehmen. Es beschreibt den Eintritt Jesu in den göttlichen Herrschaftsbereich. Auch in der christlichen Kunstgeschichte hat die Himmelfahrt eine große Bedeutung, zum Beispiel bei der Darstellung auf Gemälden.
Die drei Tage – Montag, Dienstag und Mittwoch – vor Christi Himmelfahrt werden auch „Bitttage“ genannt, weil an diesen Tagen häufig Bittprozessionen oder sogenannte Flurumgänge stattfinden. Der Heilige Mamertus führte diese dreitägigen „Bitttage“ als Bischof des französischen Vienne ein. Er starb um 474 nach Christus und wird zur Gruppe der sogenannten Eisheiligen gezählt.
Noch heute werden die „Bitttage“ in der Kirche begangen. An diesen Tagen gehen Gläubige in einigen Regionen in Bittprozessionen durch Felder und Wälder und bitten beispielsweise um gutes Wetter, eine gute Ernte und Schutz vor Naturkatastrophen.
Auch jenseits der christlichen Bedeutung des Feiertags finden heutzutage alljährlich Wanderungen und Umzüge statt – sogenannte Herrenpartien. Am Himmelfahrtstag wird seit dem 19. Jahrhundert auch der „Vatertag“, „Herrentag“ oder „Männertag“ gefeiert. Dieser gilt als Gegenstück zum Muttertag.