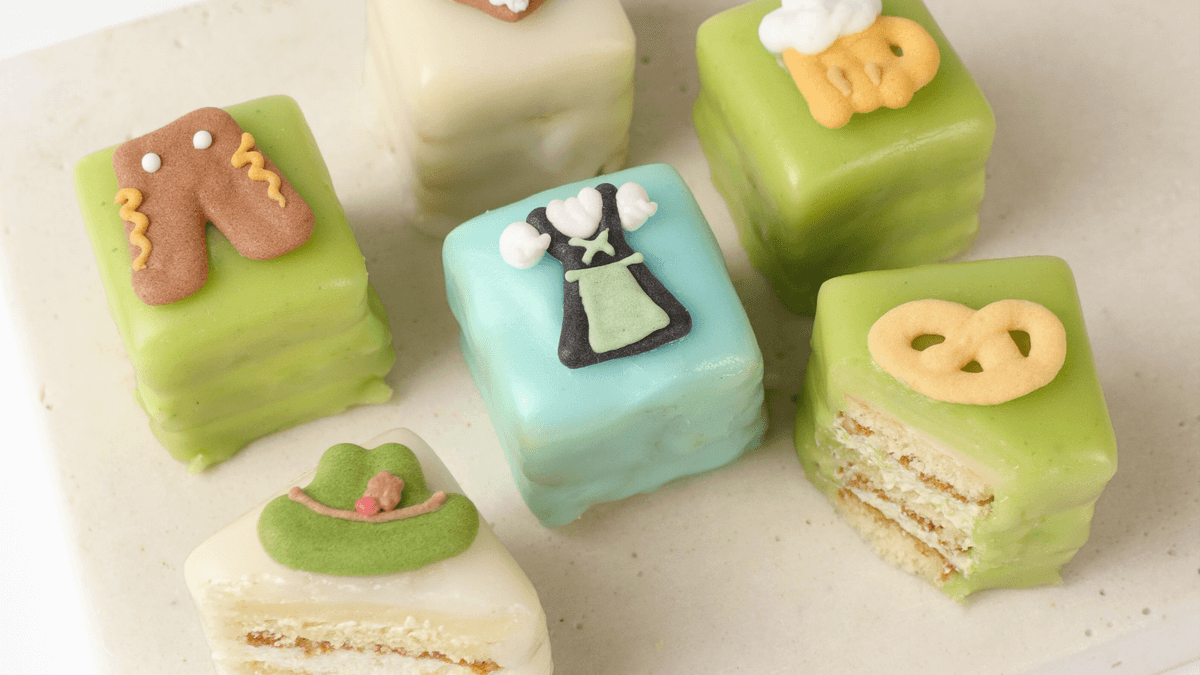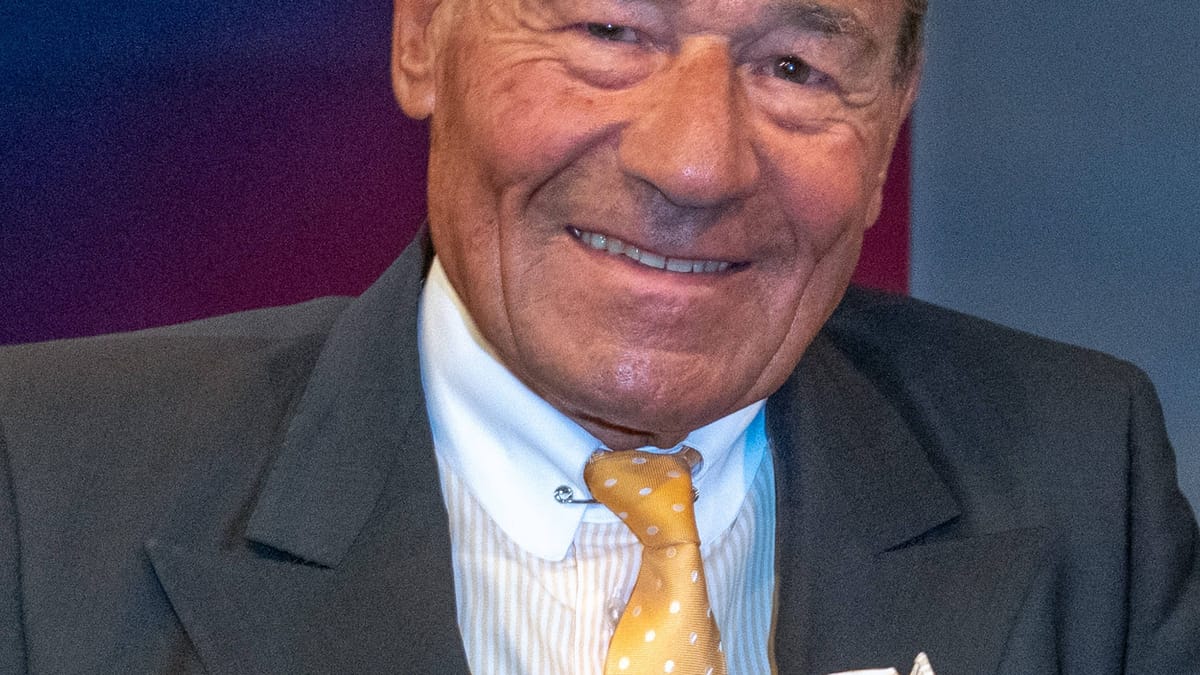Frauen in Deutschland waren dabei mehr als viermal so häufig in Teilzeit (48 Prozent) wie Männer (12 Prozent). Dies sei kein Ausdruck von Faulheit, sondern von Notwendigkeit, sagt Windscheid-Profeta. Viele beschäftigte Frauen arbeiteten in Teilzeit, weil Betreuungsangebote für Kinder oder Pflegebedürftige fehlten. Ein weiterer Grund ist das Ehegattensplitting, das Paare begünstigt, bei denen ein Partner deutlich mehr verdient. Für den anderen Partner lohnt es sich dann häufig nicht, selbst zu arbeiten oder aufzustocken.
Doch trotzdem hält Windscheid-Profeta die hohe Quote für ein Problem. „Viele wollen mehr arbeiten, aber bleiben in der Teilzeitfalle hängen“, sagt der Soziologe. Die Teilzeitfalle beschreibt ein strukturelles Problem: Wer einmal in Teilzeit arbeitet, bleibt oft dauerhaft darin gefangen und hat somit geringeres Einkommen, schlechtere Aufstiegschancen und langfristig niedrigere Rentenansprüche
Auch IW-Ökonom Holger Schäfer sieht die vielen Beschäftigten, die nicht Vollzeit arbeiten, kritisch. In dieser Gruppe stecke das größte Potenzial, um die Quote der Arbeitsstunden zu erhöhen. „Die Teilzeitler sind die am niedrigsten hängenden Früchte“, sagt Schäfer.
Um eine Trendwende einzuleiten, bräuchte es keine moralischen Appelle. Der Ökonom erklärt: „Jeder bestimmt selbst, wie viel er arbeitet“, das sei keine Entscheidung von Politik oder Ökonomie. Doch die Politik könne die Rahmenbedingungen ändern, um längeres Arbeiten attraktiver zu machen. Deshalb müsse der Staat etwa die Betreuungs-Infrastruktur ausbauen und die Abgabenbelastung verringern, damit eine Erhöhung der Stunden möglich wird und sich auch lohnt.
Zudem solle die schwarz-rote Koalition einige ihrer Gesetzesvorhaben stoppen. Dazu zählt er etwa die Familienstartzeit, die einen zweiwöchigen Urlaub für den Partner nach der Geburt eines Kindes vorsieht, sowie das Familienpflegegeld, das Menschen ausgezahlt werden soll, die ihre Erwerbstätigkeit für die Pflege von Angehörigen aussetzen. Dies seien zwar „ehrenwerte Zielsetzungen“, doch letztlich „staatliche Prämien dafür, dass jemand nicht arbeitet“, so Schäfer.
Eine Hürde für die Erhöhung der Arbeitsstunden dürften jedoch die Arbeitnehmer selbst sein. Denn nach ihrem Wunschwochenpensum gefragt, erklärte im Jahr 2023 eine Mehrheit, dass sie eher weniger Zeit im Job verbringen wollen. Laut Sozio-ökonomischem Panel wünschten sich die Menschen in Deutschland im Schnitt eine wöchentliche Arbeitszeit von 32,8 Stunden.